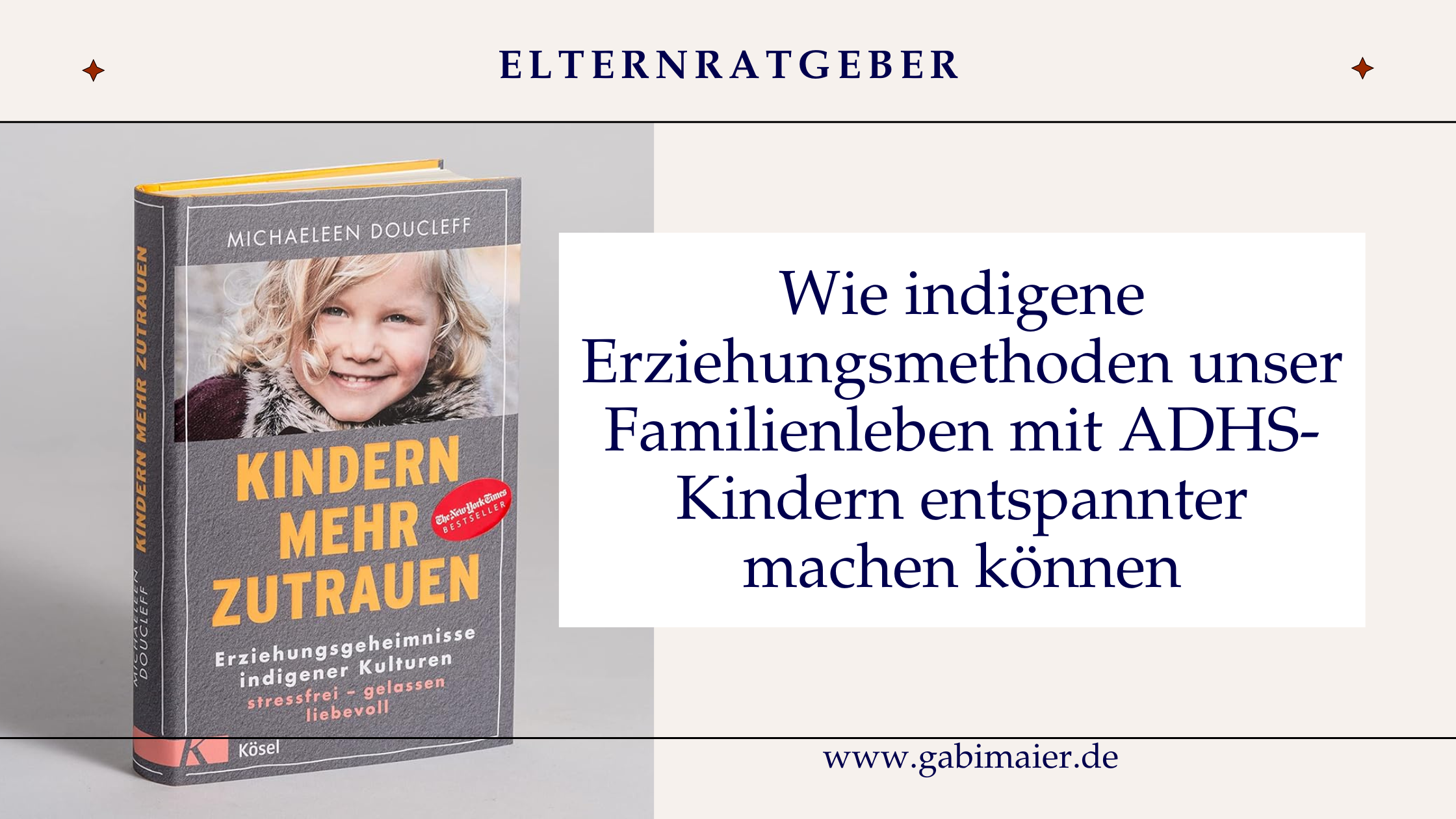Wie indigene Erziehungsmethoden unser Familienleben mit ADHS-Kindern entspannter machen können
Es ist bei uns leider sehr normal, dass sich meine Kinder häufig streiten. Ich habe zwei Söhne, die 4 ½ und 8 Jahre alt sind. Mein ältester Sohn ist sowohl auf dem ADHS- als auch auf dem Autismusspektrum, und mein jüngerer zeigt ebenfalls neurodivergente Tendenzen. Vor allem der Ältere ist oft eifersüchtig auf seinen kleinen Bruder. Er provoziert ihn, nimmt ihm seine Spielsachen weg, und nicht selten endet das Ganze in lautstarken Streitereien. Das belastet unser Familienklima sehr und macht schöne Momente oft kaputt, bevor sie überhaupt richtig entstehen können.
Eifersucht und Geschwisterstreit sind natürlich in fast allen Familien ein Thema, aber bei Kindern mit ADHS kommt noch eine besondere Dynamik hinzu. Impulsivität, Schwierigkeiten in der Emotionsregulation und ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit machen Konflikte oft intensiver und hartnäckiger. Streit kann dann nicht einfach „verpuffen“, sondern eskaliert schneller und hält länger an. Dazu kommt, dass neurodivergente Kinder oft das Gefühl haben, weniger verstanden zu werden. Und schon sind wir mitten in einem Kreislauf aus Missverständnissen, Wut und Verletzungen.
Weil mich diese Streitereien einfach total nerven, bin ich ständig auf der Suche nach guten Büchern oder Studien, die mir bei meinem Problem neue Impulse geben können. Nicht alles, was man findet, ist wirklich hilfreich. Viele Ratgeber bleiben an der Oberfläche oder schlagen Strategien vor, die im Alltag mit ADHS-Kindern kaum umsetzbar sind.
Aber vor etlichen Monaten bin ich in der New York Times auf ein Buch gestoßen, das mich neugierig gemacht hat: Hunt, Gather, Parent. What Ancient Cultures Can Teach Us About the Lost Art of Raising Happy, Helpful Little Humans von Michaeleen Doucleff (auf Deutsch: Kindern mehr zutrauen: Erziehungsgeheimnisse indigener Kulturen). Der Titel sprach mich sofort an, und ich habe das Buch innerhalb weniger Tage durchgelesen.
Michaeleen Doucleff ist Wissenschaftsjournalistin und Mutter. Der Grund für das Verfassen ihres Buches war ihre eigene Frustration mit der Art, wie in westlichen Ländern Elternschaft oft aussieht: übervolle Terminkalender, ständiges Ermahnen, zu viel Struktur und eine Menge Stress. Also nahm sie kurzerhand ihre kleine Tochter und reiste in drei indigene Gemeinschaften, um dort ihre eigene Forschung zu betreiben: zu den Maya in Mexiko, den Inuit weit oben im arktischen Norden und den Hadzabe in Tansania. Ihr Ziel war es, herauszufinden, wie Eltern dort ihre Kinder erziehen, und warum diese Kinder oft so überaus hilfsbereit, ausgeglichen und sozial wirken.
Helfen als selbstverständlicher Teil des Lebens: die Maya
Was Doucleff beobachtete, war erstaunlich. Bei den Maya etwa werden Kinder von klein auf als aktive Mitglieder der Familie betrachtet. Niemand hängt Listen mit Haushaltsaufgaben an den Kühlschrank oder verteilt Belohnungssterne. Stattdessen werden Kinder einfach selbstverständlich in alle Aufgaben eingebunden, sei es Kochen, Gartenarbeit oder Wäscheaufhängen. Sie lernen durch Zuschauen und Mitmachen, fühlen sich gebraucht und werden von innen heraus motiviert, zu helfen. In unserer westlichen Welt setzen wir dagegen oft auf Belohnungen oder Strafen mit dem Nebeneffekt, dass die Motivation von außen kommt und schnell wieder verschwindet.
Ruhe statt Strafe: die Inuit
Bei den Inuit fiel Doucleff vor allem auf, wie ruhig und gelassen Eltern auf das Fehlverhalten ihrer Kinder reagieren. Wenn ein Kind schlägt, schreit oder trotzt, gibt es keine scharfen Worte oder Strafen, sondern stille, sanfte Korrektur. Eltern bleiben gelassen, oft lächeln sie sogar leicht und vermitteln so, dass Emotionen zwar da sein dürfen, aber nicht eskalieren müssen. Kinder lernen dadurch, ihre Gefühle zu regulieren, und zwar nicht aus Angst, sondern aus einem Gefühl von Sicherheit.
Selbstständigkeit durch Vertrauen: die Hadzabe
Die Hadzabe in Tansania wiederum lassen ihre Kinder sehr früh eigene Entscheidungen treffen. Schon kleine Kinder dürfen frei spielen, das Dorf erkunden und Verantwortung übernehmen. Und dies stets in dem Wissen, dass die ganze Gemeinschaft im Hintergrund da ist. Doucleff nennt das „Alloparenting“ – wenn nicht nur die Eltern, sondern viele Erwachsene und ältere Kinder Verantwortung füreinander übernehmen.
Das TEAM-Prinzip
Aus diesen Beobachtungen leitet Doucleff vier Prinzipien ab, die sie TEAM nennt: Togetherness (Gemeinsamkeit), Encouragement (Ermutigung), Autonomy (Autonomie) und Minimal Interference (minimales Eingreifen). Kinder sollen gemeinsam mit den Erwachsenen das Leben gestalten, ermutigt werden, sich auszuprobieren, möglichst viel Eigenständigkeit entwickeln und dabei nicht ständig von Erwachsenen korrigiert oder gesteuert werden.
Warum das für neurodivergente Kinder so spannend ist
Zum einen, weil es ihnen ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit gibt. Wenn sie nicht das Gefühl haben, „gemanagt“ zu werden, sondern als wichtiger Teil des Familienlebens gelten, steigt ihr Selbstwert. Zum anderen, weil das ruhige, nicht-konfrontative Reagieren, wie bei den Inuit, genau das Modell ist, das Kinder mit ADHS so dringend brauchen, um selbst ruhiger zu werden. Außerdem entfällt der ständige Streit hinsichtlich von Belohnungen und Bestrafungen, der bei ADHS oft zu endlosen Machtkämpfen führt.
Natürlich gibt es auch Kritik an dem Buch. Manche werfen Doucleff vor, indigene Kulturen zu idealisieren oder zu wenig auf die Unterschiede zu unserem modernen Alltag einzugehen. Jedoch sagt Doucleff selbst, man könne und solle nicht alles 1:1 kopieren, sondern die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Aber die Grundideen des Buches ließen sich an jede Familiensituation anpassen.
Kleine Schritte für den Alltag
Seit ich das Buch gelesen habe, versuche ich im Alltag kleine Dinge zu verändern. Statt meine Kinder mit langen Erklärungen oder Anweisungen zu überhäufen, lade ich sie einfach ein, mitzumachen. Wenn ich zum Beispiel koche, gebe ich meinem Jüngeren ein kindgerechtes Messer und lasse ihn Gemüse schneiden. Ich sage nicht „Bitte mach das jetzt“, sondern einfach: „Hier, magst du mir helfen?“ und er tut es oft mit großer Begeisterung. Beim Älteren klappt das nicht immer, aber wenn er mitmacht, ist er oft richtig stolz auf das Ergebnis.
Ich versuche auch, weniger einzugreifen, wenn die beiden anfangen zu streiten. Statt laut zu werden, atme ich tief durch, beobachte und gehe erst dazwischen, wenn es wirklich nötig ist. Nicht immer einfach, aber ich merke, dass ich selbst ruhiger bleibe, und manchmal finden sie tatsächlich eine Lösung ohne mich.
Fazit
Was ich aus Hunt, Gather, Parent mitnehme, ist vor allem dieser Gedanke: Kinder – und gerade neurodivergente – wollen dazugehören, gebraucht und ernst genommen werden. Wenn wir ihnen diesen Raum geben, wenn wir ihre Beiträge schätzen, auch wenn sie nicht perfekt sind, dann verändert sich etwas. Vielleicht nicht sofort und nicht immer sichtbar, aber langfristig wird die Beziehung stabiler, und das Familienklima entspannter.
Ich bin weit davon entfernt, die perfekte Umsetzung gefunden zu haben. Aber schon die Idee, mich weniger als „Managerin“ meiner Kinder zu sehen und mehr als Teil eines Teams, das gemeinsam den Alltag stemmt, hat meinen Blick verändert. Und wer weiß – vielleicht gibt es dann irgendwann weniger Streit und eine bessere Zusammenarbeit. Das wäre auf alle Fälle mein Wunsch!